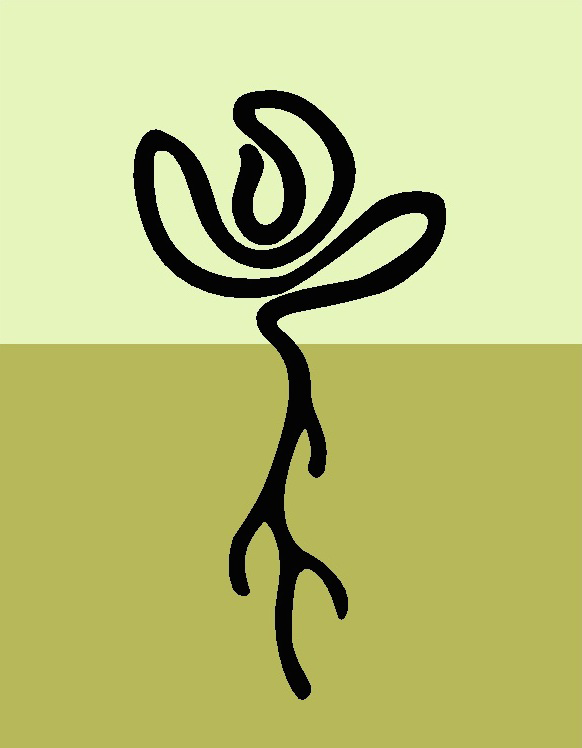Witterungsextreme
Ein gesunder Wald vermag kurzfristige Witterungsextreme wie zum Beispiel ein Sturm oder Niederschlagsmangel besser zu verkraften als ein Wald, der durch Stressfaktoren wie zum Beispiel Bodenversauerung oder Schadstoffemissionen geschwächt ist. Dauert das Witterungsereignis länger an oder fällt es stärker aus, kann es zu Schäden oder sogar zum Absterben der Bäume kommen.
Sturm
Der Schweizer Wald ist heute durch die verschiedenen Umweltbelastungen einem höheren Sturmschadenrisiko ausgesetzt. Die Windwurfanfälligkeit von Waldbäumen ist vor allem auf versauerten Böden und bei Stickstoffbelastung erhöht. Nach dem Sturm ‚Lothar’ war der Anteil geworfener Buchen in Waldflächen auf basenarmen Böden fast fünfmal und bei Fichten fast viermal grösser als auf basenreichen Standorten.

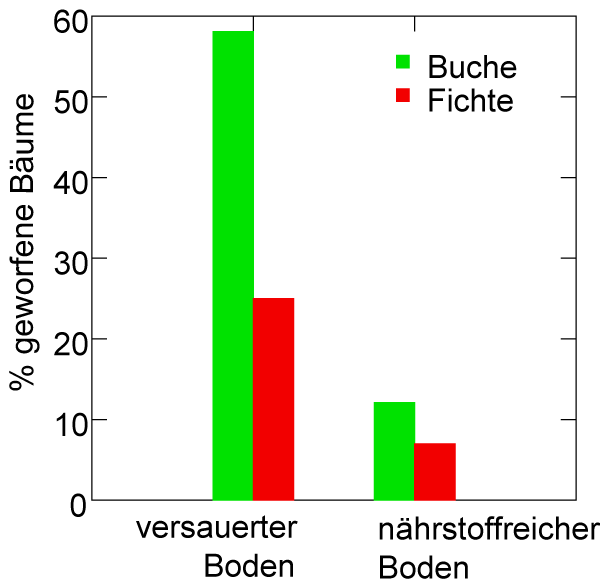
Links: Lothar-Sturmschaden in
der IAP-Waldbeobachtungsfläche Muri.
Rechts: Auf Böden mit einer tiefen Basensättigung
war der Anteil durch Lothar geworfener Buchen und Fichten stark
erhöht.
Trockenheit
Im Zusammenhang mit dem Klimawandel kommt es vermehrt zu Trockenstress im Schweizer Wald. Dieser Stress wirkt sich zusammen mit den anderen Belastungsfaktoren aus und verstärkt sie teilweise. Messungen des Bodenwassers in unseren Beobachtungsflächen seit 2001 erlauben es, die Entwicklung des Trockenstresses zu dokumentieren und die Auswirkung direkt zu erkennen. Das über die Sommermonate gemittelte Bodenwasserpotential im Wald zeigt die Trockengebiete in der Schweiz: Wallis, Genf, Jurasüdfuss und die Nordschweiz. Die Messungen werden ergänzt durch die Anwendung von hydrologischen Modellen (Wasim-ETH), die eine räumliche und zeitliche Verallgemeinerung erlauben.
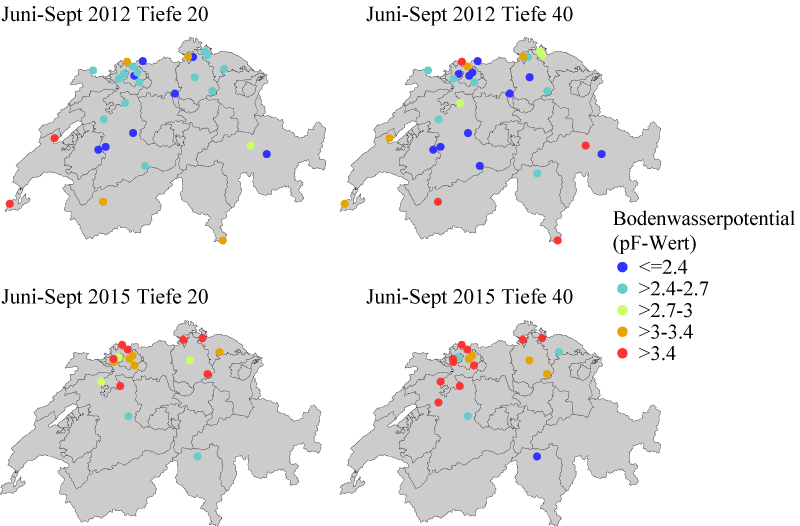
Bodenwassermessungen: mittleres
Bodenwasserpotential April-Oktober 2011 und 2012.
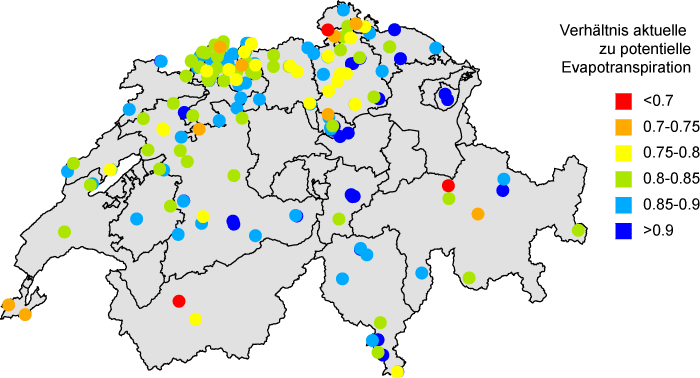
Modelliertes Trockenheitsrisiko
für IAP-Dauerbeobachtungsflächen (Mittelwert über die Jahre
1981-2011).



Sichtbare Trockenschäden an
Buchen- (links), Eichen- (mitte) und Ahornlaub (rechts).


Trockenschäden im Eichenwald bei
La Sarraz im Sommer 2015 (links) und 2019 (rechts).
Bei Trockenheit steigt die Wasserspannung in den verschiedenen Teilen
des Baumes, das Wasserpotential sinkt. Je tiefer (d.h. je stärker
negativ) das Wasserpotential ist, umso stärker ist der Stress für die
Pflanze. Bei starker Spannung reisst der Wasserfaden in den
Leitgefässen (Kavitation). Damit sinkt die Wasserleitfähigkeit der
Leitgefässe. Der Tod durch Trockenheit tritt dann ein wenn diese
Wasserleitfähigkeit um 50% (Koniferen) bzw. 90% (Laubbäume) vermindert
ist.
Das Wasserpotential im Stamm kann mittels Stammpsychrometern
aufgezeichnet werden. Eine solche Messung wurde im Sommer 2015 an
Eichen in Möhlin durchgeführt, parallel zu Messungen des Wasserflusses
im Stamm mittels Stammflusssonden. Bei zunehmender Dauer der
Trockenheit sinkt das täglich erreichte Minimum des
Stammwasserpotentials. Trotzdem schränken die Bäume den
Wasserverbrauch nur etwa auf die Hälfte ein, wie der gleichzeitig
gemessene Wasserfluss im Stamm zeigt.

Ein Messgerät für die
Wasserspannung im Stamm (Psychrometer)
wird so angebracht, dass der Sensor die
Leitgefässe im Holz berührt.
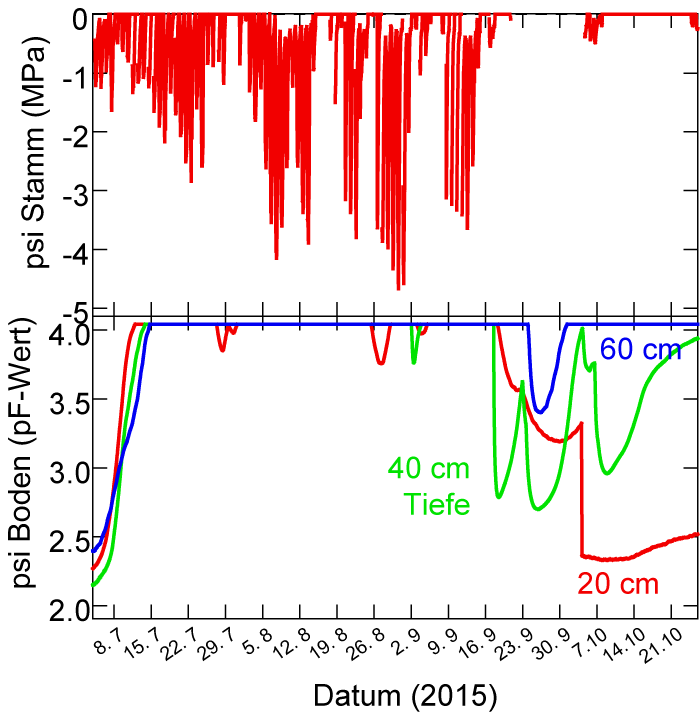
Stammwasserpotential in einer
Eiche in Möhlin im Sommer 2015, parallel
zum Bodenwasserpotential. Letzteres ist
logarithmiert. Ein pF-Wert von 4.2
entspricht einem Wasserpotential von -1.5 MPa und
bedeutet, dass das
Wasser im Boden nicht mehr pflanzenverfügbar ist.
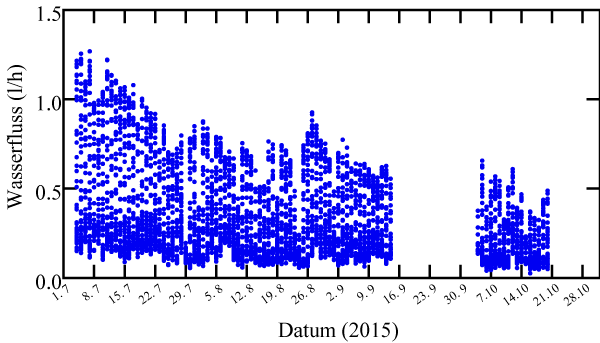
Wasserfluss im Stamm der
gleichen Eiche wie beim Stammwasserpotential.